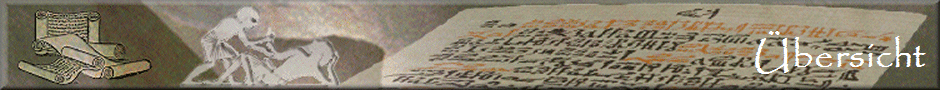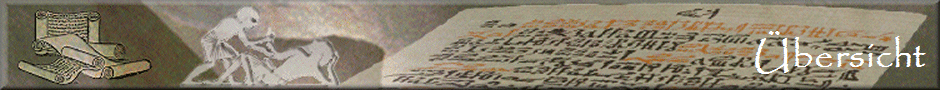|
Beschreibung
Der große medizinische Papyrus, der nach seinem Erwerber, dem Leipziger Ägyptologie-Professor Georg Ebers (* 01.03.1837, + 07.08.1898), benannt wurde, konnte von selbigem auf seiner zweiten Forschungsreise im Jahre 1873 in Theben für eine Summe von 350 Englischen Pfund (entsprechend ca. 40 Monatsgehältern von Prof. Ebers) einem einheimischen Antikenhändler abgekauft werden. Angeblich wurde der Papyrus gemeinsam mit einem zweiten (dem Papyrus Edwin Smith) bei einer Raubgrabung zwischen den Beinen einer Mumie gefunden. Um welches Grab es sich handelte und wo es sich befand, konnte dem einheimischen Verkäufer nicht entlockt werden.
Zunächst gab der Amerikaner Edwin Smith an, “neben dem grossen einen kleinen medicinischen Papyrus zu besitzen”. Wahr ist jedoch, daß zumindest der große (der spätere Papyrus Ebers) ihm vom wahren Besitzer aus unbekannten Gründen nur zeitweise zur Verfügung gestellt wurde. Warum Smith lediglich den kleinen Papyrus (den späteren Papyrus Smith) persönlich erwarb, ist unklar. Georg Ebers schrieb daraufhin: “1873 gelang es mir, bei einem längeren Aufenthalte in Theben den wahren Besitzer des Papyrus aufzufinden und so eines der ehrwürdigsten Denkmäler des ägyptischen Altherthums für Deutschland zu erwerben.”
Im Jahre 1875 bereits präsentierte Prof. Ebers der Fachwelt die berühmte Faksimile-Ausgabe seines "Papyros Ebers", die den Ägyptologen der Welt die Forschungsarbeit ermöglichte. So nutzte z.B. Georg Möller für die Zusammenstellung seiner "Hieratischen Paläographie" ausschließlich die Reproduktion, und die erste (philologisch orientierte) Übersetzung von Bendix Ebbell entstammte ebenfalls dieser Quelle.
Der ehemals ca. 18,63 Meter lange Papyrus wurde zur besseren Handhabung und Konservierung in 29 Fragmente (=Tafeln) à 2 bis 4 Kolumnen aufgeteilt und sorgfältig in Holzrahmen hinter Doppelverglasung aufbewahrt. Er befindet sich noch heute in der Universitätsbibliothek Leipzig, wo er erstmalig zu Anfang des Jahres 2002 komplett, zuletzt 2010 kurzzeitig und nur partiell ausgestellt wurde.
Insbesondere die Länge des Papyrus sorgt immer wieder für “Streitigkeiten”. So geben einige Quellen die Ausmaße mit ca. 20 Metern an, andere mit genau 20,30 Metern. Einzelne Autoren sprechen sogar von 42 Metern; woher diese Angabe auch immer stammen mag. Wahr ist, daß Georg Ebers selbst in seiner Veröffentlichung schreibt, es betrüge “die Länge des beschriebenen Theils 20,23 Meter”. Diese Maßzahl mag korrekt sein; im gesamten, zweibändigen Werk wird jedoch das wichtige Detail unterschlagen, daß die letzten acht Kolumnen (Nr. 103-110) auf die Rückseite der Papyrusrolle, genauer: auf die Rückseite der Kolumnen 94 - 102, geschrieben wurden. Somit sind bei Kolumnenbreiten von 23+19+18,5+17+20+19+19,5+18cm mindestens 154cm zuviel berechnet. Verläßlicher für die Papyrusgröße erscheint daher die Arbeit des Bibliotheksassistenten Dr. Schröter von 1908, der eine Gesamtlänge von 18,51m ermittelte (nachdem aus konservatorischen Gründen für Reparaturzwecke an anderen Stellen das Schutzblatt vor Kolumne 1 um ca. 10 Zentimeter gekürzt worden war).
Die "Seiten" des größten medizinischen "Buches", das uns derzeit vorliegt, wurden nachträglich und vermutlich von zwei unterschiedlichen Schreibern numeriert. Dabei wurden die Seitenzahlen 28 und 29 ausgelassen, so daß die letzte Kolumne die Nummer 110 trägt. Ob es sich hierbei um ein Versehen oder gar Intention handelt (wegen der besonderen Bedeutung der Zahl 110 als das ideale Lebensalter eines Menschen), ist nicht klar bzw. zu klären. Bis Seitenzahl 60 scheint die Handschrift mit der des Kalendariums-Schreiber identisch zu sein und wechselt dann. Daher ergibt sich auch ab den sechziger Seitenzahlen die plötzliche Änderung bei den auf "5" endenden Zahlen. Waren bis einschließlich Kolumne 55 die Fünfen als Einzelzeichen geschrieben, finden sich ab Zahl 65 nur noch 5 einzelne Striche - eine recht ungewöhnliche Schreibung für diese Ziffer.
Der Papyrus Ebers ist eine sog. Sammelhandschrift, eine Kompilation, die vermutlich durch einen Schreiber aus diversesten Einzelquellen zusammengestellt, sortiert und aufgeschrieben wurde. Beweise dafür findet man z.B. im Rezept 57, wo in roter Tinte mitten im Text eingefügt ist: “zerstört vorgefunden”. Zur Person des Schreibers, der dieses Meisterwerk ägyptischer Schreibkunst vollbracht hat, erfährt man aus dem Text nichts. Die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, mit der die Schrift ausgeführt ist, läßt vermuten, daß es sich um einen Berufsschreiber, nicht um einen Arzt handelte. Die kalligraphische Leistung und das (wahrscheinlich) fehlende medizinische Wissen des Schreibers lassen daher auch den einen oder anderen Fehler, der sich eingeschlichen hat (und manchmal auch von anderer Hand korrigiert wurde) oder der evtl. bereits in der Vorlage präsent war, erklärlich werden und schnell verzeihen. Manch ein Irrtum kann erst allein aufgrund der peniblen Ausführung der Schriftzeichen erkannt werden; einer liederlichen Schreibung wagt man ihn nicht anzukreiden.
Wenn der Papyrus bei seinem Erwerb noch unversehrt und vollständig war, so liegen uns jetzt nur noch 88 der insgesamt 108 Kolumnen vor. Folgende Tafeln bzw. Kolumnen sind während des 2. Weltkrieges verloren gegangen bzw. beschädigt worden:
- Tafel XIII verloren (=Kolumnen 48 + 49)
- Tafel XV: nur Kolumne 53 vollständig erhalten, 54 und 56 fragmentarisch erhalten,
55 verloren
- Tafel XXIV verloren (=Kolumnen 80 - 82)
- Tafel XXVIII: von der Vorderseite Kolumnen 95 und 97 größtenteils, Kolumne 96 vollständig sowie Kolumnen 94 und 97 nur
fragmentarisch erhalten; auf der Rückseite Kolumnen 107 und 108 vollständig, 109 größtenteils sowie 106 fragmentarisch erhalten;
die Kolumnen 93 und 98 (Vorderseite) sowie 106 und 110 (Rückseite) sind vollständig verloren
- Tafel XXIX verloren (=Kolumnen 99 - 102 der Vorderseite, 103 - 105 der Rückseite)
Ob wirklich alle vermissten Tafeln als “Kriegsverlust” zu bezeichnen und damit auf ewig verloren sind, oder ob es auch Teile als “Kriegsbeute” irgendwohin verschlagen hat, kann natürlich nicht endgültig bewiesen werden. Das kleine Fünkchen Hoffnung, den Papyrus vielleicht irgendwann wieder weitgehend vollständig zu sehen, glimmt allerdings nur sehr schwach.
Interessanterweise befand sich wohl im Nachlass von Prof. Hermann Grapow, einem der Mitbearbeiter des “Grundrisses der Medizin der Alten Ägypter” eine Tafel des Papyrus Ebers, die dann nach seinem Tode 1967 wieder den Weg zurück nach Leipzig fand.
Der Papyrus ist aus insgesamt 48 Blättern mit ca. 2 cm breiten Klebungen zusammengesetzt. Die Klebungen sind (mit zwei Ausnahmen, siehe Kolumnen 64/65 und 65/66) so sorgfältig ausgeführt, daß man Mühe hat, sie aufzufinden. Die Breite des Einzelblattes schwankt zwischen 33 und 42 cm, die Höhe liegt bei ziemlich konstanten 30 cm. Die Blätter 1 sowie 7 bis 46 sind mit jeweils 2 Kolumnen beschrieben, deren Breite zwischen 14 und 22 cm liegt. Die Anzahl der Zeilen pro Kolumne beträgt 20 bis 23 (außer auf der letzten Kolumne 110, wo es nur noch 9 Zeilen sind). Auf Blatt 2 bis 6 sind die Kolumnen nur 6 bis 10 cm breit, so daß auf Blatt Nr. 2 insgesamt fünf Kolumnen, auf Blatt Nr. 3 bis Nr. 5 vier Kolumnen und auf Blatt Nr. 6 drei Kolumnen Platz finden. Zwei Kolumnen zeigen noch die Auffälligkeit, daß sie zunächst Zeilen in Normalbreite zeigen, dann jedoch ab etwa Seitenmitte auf eine zweispaltige Schreibweise wechseln; es handelt sich hierbei um die Kolumnen 2 und 98.
Vor Seite 1 befand sich ein ca. 20 cm breiter, unbeschriebener Teil, der wohl als "Schutzumschlag" des zusammengerollten Schriftstücks diente. Von diesem sind heute noch gut 11 cm erhalten. Auf der Rückseite von Kolumne 1 und auf dem Kopfe stehend ist ein Kalendarium, das noch extra besprochen werden soll, in abweichendem Schriftstil hinzugefügt.
Beim "Durchblättern" der einzelnen Papyrusseiten fällt rasch auf, daß von Kolumne 21 auf Kolumne 22 ein deutlicher Umschwung in der Platzaufteilung stattfindet. Waren die Kolumnen 3 bis 21 schmal gehalten, jede Rezeptüberschrift und jeder Arzneistoff nebst Mengenangabe möglichst noch in eine neue Zeile geschrieben, wurde ab Kolumne 22 diese platzraubende Schreibweise (bis auf die erwähnte untere Hälfte der Kolumne 98) aufgegeben. Dies zeigt auch eine kleine Statistik: Die Kolumnen 1 bis 21 (= 19,4% aller Kolumnen) enthalten nur 70 von 877 (= 8%) Rezepten bzw. Einzeltexten.
Weitere Besonderheiten, wie z.B. Löschungen von Zeichen und Textpassagen, Korrekturen oder Ergänzungen o.ä., werden unter dem Menüpunkt “Anmerkungen” detailliert beschrieben sowie bei den einzelnen Kolumnen noch einmal erwähnt.
Gliederung des Inhalts
Eine feste, planhafte Gliederung des Papyrus ist nicht sicher erkennbar. Der Schreiber hat offensichtlich aus einer Reihe von Einzelrezepten ein großes Kompendium erarbeitet. Hierbei unterliefen ihm bei der Anordnung von Rezepten durchaus Fehler bzw. es wurden Rezepte doppelt in den Kanon eingereiht. Auch ist eine typische Reihenfolge “von Kopf bis Fuß” nicht nachweisbar. Jedoch gibt in vielen Fälle der Satzanfang “Beginn der Heilmittel für ...” den sicheren Hinweis auf ein neues Kapitel.
Im folgenden wurde eine Übersicht über diese Kapitel erarbeitet:
Abschnitt 1: Begleitsprüche beim Auflegen und Lösen eines Verbandes und beim Trinken von Heilmitteln
Abschnitt 2: Heilmittel für Krankheiten des Bauches
Abschnitt 3: Salben bei Krankheiten der Haut
Abschnitt 4: Rezepte gegen Schmerzstoffe und Erkrankungen der Verdauungswege
Abschnitt 5: Rezepte gegen Krankheiten des Brustraumes
Abschnitt 6: Rezepte gegen Magenkrankheiten
Abschnitt 7: Rezepte gegen die dämonische aAa-Krankheit
Abschnitt 8: Die sechs “Göttermittel”
Abschnitt 9: Heilmittel für Krankheiten des Kopfes
Abschnitt 10: Über die Rhizinuspflanze
Abschnitt 11: Heilmittel bei Krankheiten des Harntraktes
Abschnitt 12: Mittel zur Appetitanregung bei Verdauungsstörungen
Abschnitt 13: Heilmittel gegen Schleimstoffe
Abschnitt 14: einzelne, nicht zugeordnete Heilmittel
Abschnitt 15: Heilmittel gegen Husten und Asthma
Abschnitt 16: Heilmittel gegen Augenleiden
Abschnitt 17: Heilmittel gegen Bißwunden
Abschnitt 18: Heilmittel gegen nässenden Kopfausschlag
Abschnitt 19: Heilmittel für die Haarbehandlung
Abschnitt 20: Heilmittel für die Behandlung der Leber
Abschnitt 21: Heilmittel gegen Brandwunden
Abschnitt 22: Heilmittel zur Behandlung von Striemen durch Schläge
Abschnitt 23: Heilmittel zur Behandlung von Wunden
Abschnitt 24: Heilmittel zur Behandlung von Hautblasen
Abschnitt 25: Heilmittel gegen Geschwüre
Abschnitt 26: Heilmittel gegen die wSaw-Krankheit u.ä.
Abschnitt 27: Heilmittel gegen Wundsekrete
Abschnitt 28: Heilmittel für die Beine
Abschnitt 29: Heilmittel für Finger und Zehen
Abschnitt 30: Heilmittel für die “Gefäße”
Abschnitt 31: Heilmittel für die Zunge
Abschnitt 32: Heilmittel für die Spn-Erkrankung
Abschnitt 33: Heilmittel für die Behandlung der Körperoberfläche
Abschnitt 34: Heilmittel für die Zähne
Abschnitt 35: Heilmittel für die Behandlung dämonischer Erkrankungen
Abschnitt 36: Heilmittel für die rechte Bauchhälfte
Abschnitt 37: Heilmittel für Schnupfen
Abschnitt 38: Heilmittel für die Ohren
Abschnitt 39: Heilmittel für Haarausfall
Abschnitt 40: Heilmittel für gynäkologische Erkrankungen
Abschnitt 41: Prognosen für Neugeborene
Abschnitt 42: Hausmittel
Abschnitt 43: Abhandlung über Anatomie und Physiologie des Herzens und der Gefäße
Abschnitt 44: Abhandlung über Schmerzstoffe
Abschnitt 45: Abhandlung über Geschwülste
Literatur
Bardinet, Thierry: “Les papyrus médicaux de l‘Egypte pharaonique. Traduction intégrale et commentaire”, Paris 1995
- Papyrus Ebers S. 157-193, 251-373, 443-451
Beckerath, Jürgen von: “Bemerkungen zum ägyptischen Kalender, III – Zum Kalendarium des Papyrus Ebers”, ZÄS 120, 1993, S. 131-136
Ebbell, Bendix: “The Papyrus Ebers. The greatest Egyptian Medical Document”, Kopenhagen 1937
Ebbell, Bendix: “Der chirurgische Teil des Papyrus Ebers”, in: Acta Orientalia 7, 1929, S. 1-47
Ebers, Georg: “Papyros Ebers – Das hermetische Buch über die Arzeneimittel der alten Ägypter in hieratischer Schrift”, 1875 (Nachdruck 1987), 2 Bände
Ghalioungui, Paul: “The Papyrus Ebers. A New English Translation, Commantaries and Glossaries”, Cairo 1987
Grapow, Hermann: “Beschreibung und Kollation des Papyrus Ebers”, in: ZÄS 84, 1959, S. 38-54
Joachim, Heinrich: “Papyros Ebers – Das älteste Buch über Heilkunde”, 1890 (Nachdruck 1973)
Oefele, Felix Freiherr von: “Zur Quellenscheidung des Papyrus Ebers”, Achriv für Geschichte der Medizin 1, 1907
Scholl, Reinhold: “Der Papyrus Ebers. Die größte Buchrolle zur Heilkunde Altägyptens”, Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig 2002
Westendorf, Wolfhart: “Handbuch der altägyptischen Medizin”, 2 Bände, Brill Verlag, Leiden/Boston/Köln, 1999
- Teil I “Die Quellen”, Kap. 5, S. 22-35
- Teil VI “Die bedeutendstenPapyri in zusammenhängender Übersetzung - Papyrus Ebers”, S. 547-710
Wreszinski, Walter: ”Der Papyrus Ebers – Umschrift ”, Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1913
|